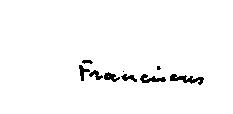Wenigstens schwarze Zahlen
Nach einer turbulenten „Finanzwoche“ wartete der Vatikan heute mit positiven Meldungen aus dem Wirtschafts-Bereich auf. Die Haushalte des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaats haben 2012 mit Gewinnen abgeschlossen: der Heilige Stuhl, sozusagen die Verwaltung der Weltkirche, mit einem Plus von 2,18 Millionen Euro, der Staat der Vatikanstadt sogar mit einem Plus von 23 Millionen Euro. Der Vatikanstaat konnte damit sein Plus gegenüber 2011 um mehr als eine Million Euro steigern. Ein Großteil der Einnahmen stammt aus dem Erlös der Eintrittsgelder der jährlich mehr als fünf MIllionen Besucher der Vatikanischen Museen sowie aus dem Verkauf von Briefmarken durch die Vatikanpost.
 Der Heilige Stuhl hatte im vergangenen Jahr noch ein Minus von 14,9 Millionen Euro zu verbuchen. Dass in diesem Jahr ein leichter Überschuss zu verzeichnen ist, sei den guten Renditen bei den Finanzgeschäften zu verdanken. Größter Ausgabenposten für den Heiligen Stuhl sind die Gehälter für die 2.823 Mitarbeiter sowie die Kosten für die vatikanischen Medien (v.a. Radio Vatikan und die Tageszeitung L’Osservatore Romano). Zudem habe 2012 die neue Immobiliensteuer zu Mehrausgaben von rund fünf Millionen in diesem Bereich geführt. Der Vatikanstaat hatte Ende 2012 übrigens 1.936 Mitarbeiter.
Der Heilige Stuhl hatte im vergangenen Jahr noch ein Minus von 14,9 Millionen Euro zu verbuchen. Dass in diesem Jahr ein leichter Überschuss zu verzeichnen ist, sei den guten Renditen bei den Finanzgeschäften zu verdanken. Größter Ausgabenposten für den Heiligen Stuhl sind die Gehälter für die 2.823 Mitarbeiter sowie die Kosten für die vatikanischen Medien (v.a. Radio Vatikan und die Tageszeitung L’Osservatore Romano). Zudem habe 2012 die neue Immobiliensteuer zu Mehrausgaben von rund fünf Millionen in diesem Bereich geführt. Der Vatikanstaat hatte Ende 2012 übrigens 1.936 Mitarbeiter.
Wie schon in den vergangenen Jahren gab es zur Vorstellung der Bilanzen keine Pressekonferenz, sondern lediglich eine Mitteilung des vatikanischen Presseamts. Auch wurden keine Details über Ausgaben und Einnahmen mitgeteilt. Das passt nicht so richtig zur viel beschworenen neuen Transparenz. Vielleicht war aber auch die Zeit zu kurz, um auf diese neue Entwicklung zu reagieren. Allerdings wird schon seit Jahren von Journalisten reklamiert, dass die Zahlen nicht nachvollziehbar offen gelegt werden. Immerhin geht es zu einem großen Teil auch um Spendengelder der Gläubigen.
In diesem Bereich wurden, wie üblich, wenigstens einige Zahlen veröffentlicht. Und die müssten bei den Kardinälen im Vatikan die Alarmglocken schrillen lassen. So ist etwa der Erlös aus dem sogenannten „Peterspfennig“ von 69,7 Millionen US-Dollar (53,7 Millionen Euro) im Jahr 2011 auf 65,9 Millionen US-Dollar (50,8 Millionen Euro) gesunken, ein Minus von über 5 Prozent. Auch die Zuwendungen aus den Diözesen in aller Welt sind von 32,1 Millionen US-Dollar (24,7 Millionen Euro) um 11,9 Prozent auf 28,3 Millionen US-Dollar (21,8 Millionen Euro) gesunken. Dieser Rückgang lässt sich sicherlich nicht allein durch die Wirtschaftskrise erklären, sondern dürfte auch inhaltliche Gründe haben.
Die Vatikanbank IOR hat 2012 übrigens 50 Millionen Euro ausgeschüttet, die dem Papst zur Verwendung für soziale Zwecke zur Verfügung stehen. Dazu kamen noch fünf Millionen Euro des IOR an verschiedene Fonds, unter anderem zur Unterstützung von Klausurklöstern oder den Kirchen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.