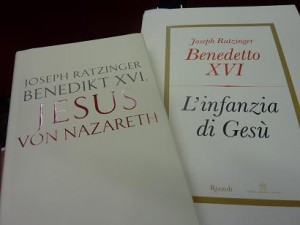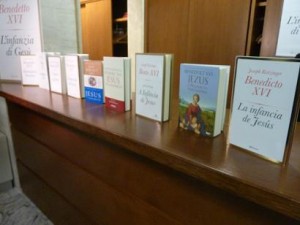Der „Senat“ der Kirche
Seit 1927 gab es kein Konsistorium mehr, bei dem nicht ein Italiener zum Kardinal kreiert wurde. Viele Italiener können es kaum fassen. Doch beim aktuellen Konsistorium mussten nicht nur die Italiener warten; es ist keiun Europäer dabei und damit auch nicht der Chef der (zweit-)wichtigsten Vatikanbehörde: Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, Präfekt der Glaubenskongregation.
 Die Kardinäle beraten den Papst und die verschiedenen Behörden des Heiligen Stuhls – daher die Bezeichnung „Senat der Kirche“. Die wohl wichtigste Aufgabe ist die Wahl eines neuen Papstes nach dem Rücktritt oder dem Tod eines Pontifex. Alle Kardinäle, die am Tag vor dem Rücktritt oder dem Tod eines Papstes das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ziehen in ein Konklave ein. Das sind mit dem heutigen Tag 120 der insgesamt 211 Kardinäle. Papst Paul VI. hatte festgelegt, dass die Zahl der Papstwähler nicht über 120 liegen soll; doch haben sich in der Vergangenheit die Päpste auch immer wieder über diese Bestimmung hinweggesetzt.
Die Kardinäle beraten den Papst und die verschiedenen Behörden des Heiligen Stuhls – daher die Bezeichnung „Senat der Kirche“. Die wohl wichtigste Aufgabe ist die Wahl eines neuen Papstes nach dem Rücktritt oder dem Tod eines Pontifex. Alle Kardinäle, die am Tag vor dem Rücktritt oder dem Tod eines Papstes das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ziehen in ein Konklave ein. Das sind mit dem heutigen Tag 120 der insgesamt 211 Kardinäle. Papst Paul VI. hatte festgelegt, dass die Zahl der Papstwähler nicht über 120 liegen soll; doch haben sich in der Vergangenheit die Päpste auch immer wieder über diese Bestimmung hinweggesetzt.
Noch immer kommt mehr als die Hälfte der Papstwähler aus Europa: 62 (allein 28 aus Italien). Aus Südamerika (21 Papstwähler), Afrika und Asien (je11) sowie Ozeanien (1), wo rund 66% der Katholiken leben, kommen nur 44 wahlberechtigte Kardinäle (d.h. 36%). Um dieses Missverhältnis etwas auszugleichen, hatte Papst Benedikt XVI. dieses Mal nur Nichteuropäer ernannt. Von einer gerechten Verteilung ist die Kirche aber noch weit entfernt. Umso mehr wenn man bedenkt, dass die Wachstumsregionen der katholischen Kirche in Asien und Afrika liegen. Derzeit gibt es neun deutsche Kardinäle, von denen sechs wahlberechtigt wären: der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner (78), der Mainzer Bischof Karl Kardinal Lehmann (76), der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx (59), der Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki (56), der ehemalige vatikanische Ökumeneminister Walter Kardinal Kasper (79) sowie der ehemalige vatikanische Entwicklungshilfeminister Paul Josef Kardinal Cordes (78).
Die neuen Kardinäle kommen zum größten Teil aus „Krisenzentren“ der katholischen Kirche. Patriarch Bechara Boutros Rai versucht im Libanon das fragile Mächteverhältnis zwischen Christen und Muslimen zu stärken. Angesichts des Konflikts im Nachbarland Syrien ist das eine schwierige Aufgabe. Mit seinem Besuch Mitte September in Beirut wollte Benedikt XVI. das Engagement der Kirche um Frieden und Versöhnung unterstützen. Der Inder Baselios Cleemis Thottunkal steht an der Spitze der rund 300.000 Mitglieder zählenden syro-malankarischen Kirche. Ihre Mitglieder klagen seit Jahren immer wieder über Diskriminierung und Gewalt in ihrer Heimat.
Kardinal John Olorunfemi Onaiyekan sucht als Vorsitzender der nigerianischen Bischofskonferenz den Dialog mit gemäßigten Muslimen, um gemeinsam den Islamisten der Terrorgruppe Boko Haram im Land begegnen zu können. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Anschläge von Islamisten auf christliche Kirche, vor allem im Norden Nigerias. Onaiyekan erhielt vor wenigen Tagen den diesjährigen Friedenspreis von Pax Christi International. Kardinal Ruben Salazar Gomez engagiert sich als Vorsitzender der kolumbianischen Bischofskonferenz seit 2008 im Streit zwischen Regierung und der linksgerichteten Rebellenorganisation FARC. Der 70-Jährige kritisiert Menschenrechtsverletzungen bei allen Konfliktparteien, auch der Armee. Durch diese Unabhängigkeit genießt er großen Respekt in seinem Heimatland. Kardinal Louis Antonio Tagle kommt von den Philippinen, der katholischen Hochburg in Asien. Nur in Brasilien und Mexiko leben mehr Katholiken als auf dem Inselstaat. Der 55-Jährige ist ein Experte für das II. Vatikanische Konzil und gilt für Beobachter als einer der wenigen asiatischen Papabile.
Das Konsistorium vom Wochenende ist das fünfte Konsistorium zur Kreierung neuer Kardinäle im Pontifikat von Papst Benedikt XVI. und das zweite in diesem Jahr. Benedikt XVI. hat damit insgesamt 90 Kardinäle ernannt. Auch wenn das aktuelle Konsistorium noch abgeschlossen ist, gibt es bereits Spekulationen, wann das nächste stattfindet. Ob dies schon zum Fest Cathedra Petri am 22. Februar kommt, ist ungewiss. Denn bis dahin werden nur zwei Kardinäle das 80. Lebensjahr vollenden. Nähme Benedikt noch die Plätze der vier Kardinäle (darunter Kardinal Kasper) dazu, die bis Ende März 80 Jahre alt werden, hätte er immerhin sechs Plätze. Wartet er bis zum Christkönigsfest 2013 hätte er 10 Plätze zu vergeben – immer vorausgesetzt, er geht nicht über die „Sollgrenze“ von 120 Papstwählern.